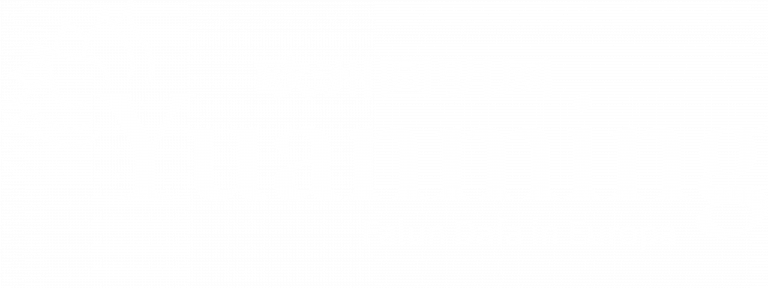Wie ist mit einem Regime umzugehen, das sich zunehmend modern und westlich präsentiert, in Wirklichkeit aber weder Menschenrechte noch demokratische Prinzipien anerkennt? In Europa und Amerika behandelt man Chinas Herren mit Blick auf das Wirtschaftspotenzial wie ehrbare Politiker. Diese Haltung verletzt demokratische Grundsätze und stärkt die KPCh. Von unserem Korrespondenten Ulrich Schmid
Peking, im Juni . . . those old men who are drunk on their false sense of power and the flattery of boot-licking foreigners, have completely lost their senses. (Wei Jingsheng) Einige Zeit nach dem Untergang der DDR kam eine linke deutsche Tageszeitung zum ernüchternden Schluss, dass im Grunde nur die ganz Rechten in der Bundesrepublik in all den vergangenen Jahren ein einigermassen adäquates Bild des zusammengebrochenen anderen Teils Deutschlands gezeichnet hätten. Die Linken, hieß es, hätten in ihrem berührenden Bemühen um Fairness die abgrundtiefe Verkommenheit des SED-Regimes ganz einfach nie recht begriffen: Alles sei noch viel schlimmer gewesen, als man angenommen habe. Leicht fiel der Linken dieses Eingeständnis nicht. Dem romantischeren Teil der Genossen bereitet es bis heute Mühe, zuzugeben, dass die DDR durchaus mörderische Züge hatte und dass es gerade die Ideale kommunistischer Gleichheit und Gerechtigkeit waren, die bis zum Sturz der Mauer mit Füssen getreten wurden. Pragmatischere Linke allerdings ließen sich von dem, was man nach der Wende in den Trümmern der Ostrepublik vorfand, ebenso beeindrucken wie die Rechte: Hier hatte ein wahrhaft fürchterliches Regime sein Ende gefunden.
Staat ohne freie Bürger
Wenn das kommunistische Regime in China stürzt, wird die Ernüchterung noch viel grösser sein. Denn im Vergleich zu dem, was die KP Chinas ihren Untertanen im Namen von Freiheit, Gleichheit und Fortschritt antut, nehmen sich die Verbrechen der Stasi und ihrer Hintermänner so bescheiden aus wie das spießige Refugium der SED-Oberen in Wandlitz neben dem imperialen Sperrgebiet von Zhongnanhai. Die Fakten sind unbestritten. In China werden die Menschenrechte mit Füssen getreten, immer noch und immer mehr. Die Bürger sind entmündigt, dürfen ihre Regierung nicht wählen, dürfen sich nicht frei versammeln und dürfen keine Parteien bilden. Die Justiz spricht nicht Recht, sondern sichert die Herrschaft der Partei. Nach wie vor gibt es keine Form legitimen Dissenses; wer ein paar Voten gegen den Drei-Schluchten-Staudamm im Parlament für erste Regungen eines erwachenden Pluralismus hält, unterschätzt den Sinn der Regierung für taktische Finesse. Unzählige haben ihre Freiheit wegen «konterrevolutionärer Umtriebe» verloren; kein Land hat mehr politische Gefangene. Tausende werden jährlich hingerichtet, viele nach zweifelhaften Prozessen. Das alles ist bekannt. Aber man redet nicht gerne darüber, weil es so «unkonstruktiv» ist, so «negativ» und «altmodisch», weil es so sehr nach bemühter Rechthaberei schmeckt, weil man damit «ja doch nicht weiterkommt» und man schliesslich weiterkommen will, vor allem geschäftlich. Chinas Herren verstehen es meisterhaft, den Widerwillen vieler Intellektueller, fremden Kulturen gegenüber besserwisserisch aufzutreten und «grundsätzlich anderes» an westlichen Ellen zu messen, auszunutzen. Natürlich wissen sie genau, was den Westlern zu entgehen scheint: dass Kritik an Diktatur, Willkür und Terror nicht Kritik an einer Kultur ist, dass Menschenrechte unteilbar sind, also auch für die Chinesen gelten, und dass es keineswegs von einer Geringschätzung Chinas zeugt, wenn man auch die Geplagten und die Dissidenten ernst nimmt. China «gerecht werden» heisst nicht wegsehen. Doch zu beunruhigen braucht derlei Wissen die Kommunisten nicht. Erfolgreich haben sie nackte Repression zu einer Frage der Etikette gemacht, und mit Vergnügen können sie zusehen, wie brave, allem Fremden gegenüber aufgeschlossene Westler Mal für Mal in die Kulturfalle tappen, wie sie aus schierer Angst vor politischer Unkorrektheit den rüdesten Despotismus entschuldigen. Vor allem in Europa hat sich in Bezug auf China mittlerweile eine niederschmetternde Kultur des eiligen Verstehens entwickelt, ein wahrer Wettbewerb des Erklärens und Verzeihens, der fatal an die Appeasement- Gesten vor dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Unverständlich ist vor allem die Haltung der linken und liberalen Intelligenz. Eine Gemeinschaft, die zu Recht dafür kämpft, dass Auschwitz nicht aus dem öffentlichen Diskurs verschwindet, die sich einst zu Recht über die Diktatoren in Lateinamerika erregte, die heute zu Recht aufmerksam und argwöhnisch den aufkeimenden Rechtspopulismus beobachtet – diese Gemeinschaft ignoriert das Unaussprechliche, das Tag für Tag in China geschieht.
Vernachlässigte Oppositionelle
So weit geht der Drang nach Apologie, dass sich Geschäftsleute und Diplomaten bei chinesischen Politikern für das «unhöfliche» Benehmen mancher Menschenrechtler und Journalisten entschuldigen. Das ist umso erstaunlicher, als die chinesischen Kommunisten all das in höchstem Masse verkörpern, worüber sich der aufgeklärte Europäer sonst so gerne mokiert. Wo würde das leere, sinnlose Zeremoniell intensiver gepflegt als im kommunistischen China? Wo sonst fände sich ein derartiges Übermass an hohler Rhetorik, anmassender Geste und nationalistischem Überschwang, wo aber auch so viel verbiesterte Humorlosigkeit? Und wie kann man übersehen, dass das Tun der Herrschenden nicht nur im Westen, sondern auch im Landesinneren als lächerlich und anstössig empfunden wird? Es gibt kritische Schriftsteller in China, es gibt eine Alternativkultur, es gibt die Bitterarmen – es gibt das «andere», das nicht blitzende, das nicht offizielle China, man muss nur den Mut haben, die rotgoldenen Festsäle zu verlassen und es sich anzusehen. Doch die westliche Welt verschliesst die Augen. Keine Untat, die nicht verziehen würde: In diesem Frühjahr hat es vor der Uno-Menschenrechtskommission in Genf nicht einmal mehr zu einer Verurteilung Pekings gereicht. Zur freudigen Kapitulation der Wohlanständigen gesellt sich die Unempfindlichkeit der Geschäftsleute, und dies ergibt dann jene unheilige Allianz, die heute im Umgang mit China tonangebend ist. Dass sich die hedonistischen Exponenten des längst verbürgerlichten Sozialdemokratismus mit den Vertretern der Wirtschaft mittlerweile besser verstehen als die etwas drögen Altbürgerlichen, die noch an Dinge wie Anstand und Moral glauben, ist allerdings längst bekannt und keiner Erregung mehr wert. Weit schwerer wiegt die heuchlerische Doppelmoral, die in jedem Versuch steckt, Chinas Despoten zu entschuldigen. Vielen Regierungen, die sich vor Peking verbeugen, geben die Sünden kleiner, unwichtiger Länder Anlass zu entrüsteten Protesten und harten Sanktionen. Die Beispiele Kuba und Burma liegen am nächsten, aber sie ließen sich beliebig ergänzen. Von den Freiheiten der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi können die chinesischen Dissidenten nur träumen – wann sprechen sie über den Zaun zu ihren Anhängern, wann halten sie Pressekonferenzen, wann werden ihre Freunde aus dem Arbeitslager entlassen? Lebte der Schlächter von Peking, Li Peng, in Burma, wäre er im Westen längst geächtet. In Peking stehen die westlichen Geschäftsleute und Diplomaten Schlange, um ihm die Hand zu drücken.
Das Drängen nach Würde
Das Standardargument der Kommunisten ist eines, das vielen auf den ersten Blick angenehm selbstkritisch vorkommt. China, heißt es, sei ganz einfach «noch nicht reif» für die Demokratie, sei zu groß, zu vielgestaltig und zu rückständig und brauche eine autoritäre Regierung, damit Chaos und Blutvergiessen vermieden werden könnten. Das Gegenteil ist richtig. China wird ins Chaos stürzen, wenn es nicht bald Institutionen und Mechanismen schafft, die in der Lage sind, die sozialen Widersprüche zu ventilieren. Die Kluft zwischen Regierung und Volk wächst, die Herrschenden können die Beherrschten nicht mehr verstehen: Darin liegt die Gefahr. Mag sein, heißt es dann weiter, aber die Chinesen wollten ja im Grunde gar keine Menschenrechte – das sei ihnen «kulturell fremd» -, sondern wirtschaftlichen Fortschritt, vor allem aber: Geld. Abgesehen davon, dass dieses Argument schon bei der bloßen Nennung Taiwans oder Hongkongs viel von seinem Glanz verliert, verrät es erhebliche rassistische Herablassung. Warum wehren sich in Hongkong Tausende von Menschen so verzweifelt gegen die Rückschaffung nach China? Aus simpler Geldgier? Weil sie zu Hause unweigerlich ins Elend abglitten? Unsinn, in Hongkong herrscht Arbeitslosigkeit und in den Sweatshops von Tsimshatsui verdienen die Einwanderer kaum mehr als in der Volksrepublik. In China läßt es sich, da haben die Freunde Pekings durchaus Recht, an manchen Orten ganz gut leben, wenn man den Mund hält und gute Beziehungen pflegt. Nein, den Menschen in Hongkong geht es um etwas anderes: Um Würde. Sie haben erfahren, wie es ist, in einer Bürgergesellschaft zu leben, sie wünschen sich eine Existenz ohne Furcht vor Repression und Willkür. Wer die Chinesen argumentativ auf das Niveau geldgieriger Materialisten reduziert, nimmt sie nicht ernst. Richtig ist hingegen der Hinweis, dass es in Chinas Osten – im Westen herrschen andere Verhältnisse – heute wesentlich mehr persönliche Freiheiten gibt als noch vor zehn Jahren, dass der Begriff «Fortschritt» also keine Chimäre ist und dass man gut daran täte, diese Entwicklung durch intensives Engagement, auch wirtschaftliches, zu unterstützen. Hitziger Protest oder gar eine Isolation Chinas erschwerten diese Entwicklung. Dem ist zuzustimmen. China darf nicht isoliert werden. Eine brüske Abkehr des Westens vom Reich der Mitte wäre für die demokratische Entwicklung verhängnisvoll. Handel bringt Wohlstand, Wohlstand bringt Demokratie: Das Axiom der Politologen, so unzuverlässig es im Einzelfall sein mag, wird sich grundsätzlich auch in China bestätigen. Jeder Akt merkantiler Zivilisiertheit erodiert die Legitimität der Kommunisten. Hat sich in China erst einmal eine Mittelklasse etabliert, wird der Ruf nach Partizipation rasch lauter werden. Wider den falschen «Dialog» Was aber wäre dann konkret zu tun? Worum geht es, wenn auf Isolation und ständige Proteste verzichtet werden soll? Es geht, so unspektakulär das klingen mag, um Stil. Der Umgang des Westens mit China bedarf nicht der grundsätzlichen inhaltlichen Überholung, aber ohne eine neue Tonlage wird er nicht auskommen. Die falsche Freundlichkeit, von europäischen Kanzlern, Ministerpräsidenten und Staatschefs mittlerweile bestens geheuchelt, muss distanzierter Sachlichkeit weichen, orchestrierter Überschwang und unbedarfte Verbrüderung angemessener Zurückhaltung. Natürlich, nur zu oft bestehen die Chinesen auf derartigen Orgien der «Freundschaft». Wer nicht artig jubelt und anstößt, der macht keine Geschäfte, und drum ist es auch völlig sinnlos, den armen Geschäftsleuten zu grollen, die sich mit den Regierungsvertretern, die ihnen gegen Zuwendungen aller Art den Vertragsabschluss ermöglicht haben, betrinken müssen. Gefordert ist vielmehr die Diplomatie. Natürlich darf sich ein diplomatischer Stilwechsel nicht in etwas lauterem Räuspern erschöpfen. Man kann einiges tun. Am dringlichsten ist die rasche Beendigung des sogenannten Menschenrechtsdialogs. Nichts schadet den Dissidenten und der demokratischen Entwicklung Chinas so sehr wie diese Scheindebatte. Erstens, weil sie nichts nützt. Nie wurde der Dialog intensiver geführt als in den letzten zehn Jahren, und nie, die Kulturrevolution ausgenommen, stand es um die Menschenrechte in China schlechter als heute, wie die Experten von Amnesty International und Human Rights Watch bestätigen. Zweitens, weil sie das Thema schubladisiert. Unangenehmes wird Delegationen überantwortet, und das entbindet die hohen Politiker von der Aufgabe, es anzusprechen. Drittens, weil sie die chinesischen Herren aufwertet und zum respektablen Partner in einem Dialog macht, in dem es nicht um den Austausch unterschiedlicher, aber gleichwertiger Ansichten geht, sondern um den Kampf um Menschenwürde, die auch Chinesen zusteht. Viertens, weil ein routinierter, institutionalisierter Dialog den zynischen Tauschhandel fördert und den Kommunisten Gelegenheit gibt, ihn als Druckmittel gegenüber dem Westen zu nutzen und sich ihre «Gutmütigkeit» teuer zahlen zu lassen. Für jeden Dissidenten, dessen Freilassung heute erwirkt wird, wandern morgen neue Unschuldige hinter Gitter.
Dosiertes Drehen am Geldhahn
Wirkungsvoller und ehrlicher wäre ein Zurückgehen auf die Politik der ernsten Demarche, der seltenen, aber nachhaltigen öffentlichen Ermahnung durch Regierungs- und Staatschefs, die allen Chinesen klar machte, dass ihre Führer im Westen nicht auf Erbauung stossen. Es geht auch ohne rote Teppiche und Militärkapellen, und ab und zu könnte man auch auf öffentlichen, direkt übertragenen Pressekonferenzen bestehen, bevor man den nächsten Exportkredit bewilligt. Noch wirkungsvoller wäre natürlich wirtschaftlicher Druck, aber Derartiges ist heute kein Thema mehr. Wer die wirtschaftliche Keule schwingen will, muss bereit sein, die Konsequenzen – den Verzicht auf den chinesischen Markt – zu tragen. Das ist heute niemand, und ein internationaler Boykott Chinas liefe wieder auf Isolation hinaus, ist also abzulehnen. Ohne weiteres möglich ist hingegen eine rigorose Überprüfung der Entwicklungshilfe. Viele Länder überweisen dem Land mit den weltweit zweitgrössten Devisenreserven noch heute Zahlungen in den Haushalt, und zwar à fonds perdu – ein Unding sondergleichen. Fast obszön ist auch die Inbrunst, mit der Wirtschaftsvertreter, die sonst bei jeder Gelegenheit den «freien Wettbewerb» preisen, das Prinzip der Exportrisikogarantie verteidigen. Der Steuerzahler finanziert Projekte, die im freien Wettbewerb nicht den Hauch einer Chance hätten, und die Bestechungsgelder zahlt er auch noch gleich mit. Das politische China ist heute das, was die Amerikaner so schön als «basket case» bezeichnen: eine hoffnungslose Angelegenheit. Die KP, die führende Kraft des letzten stalinistischen Grossstaats der Welt, befindet sich in aussichtsloser Lage; sie wird im Spannungsfeld von wirtschaftlicher Öffnung und dem Bemühen nach Machterhaltung untergehen, wenn nicht heute, dann morgen. Doch wie immer man sich auch zur politischen Führung Chinas stellen mag, an einer Erkenntnis kommt man nicht vorbei: China ist wichtig. Was sich hier in den nächsten zehn, zwanzig Jahren abspielt, wird unerhörten Einfluss auf das Weltgeschehen haben, in wirtschaftlicher Hinsicht sowieso, in politischer aber nicht weniger. Dass Chinas Führer klug genug sind, die Macht rechtzeitig abzugeben oder sie zu teilen, kann man hoffen; daran glauben, wie es einige tun, muss man nicht. Sicher ist nur, dass die Parteibosse wissen, dass sie in Gefahr sind. Sie versuchen den gesunden Patriotismus der Chinesen zu ihren Gunsten auszunützen und stellen sich ungeniert als die einzigen wahren Hüter nationaler Anliegen dar. Doch sie scheitern auch hier. Die meisten Chinesen haben das Spiel längst durchschaut. Sie lieben ihr Land, nicht die KP. Es sind diese Menschen, die dereinst das neue China aufbauen werden, und wenn sie das tun, werden sie sich fragen, weshalb sich so viele Ausländer dem Regime, das sie eben beseitigt haben, derart würdelos angedient haben. Im Westen wird dann so mancher um eine Antwort verlegen sein.
Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter: http://www.nzz.ch/2002/07/11/al/page-article89Y8F.html
Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG
Veröffentlicht am: 15.07.02